Rückblick auf das Wissenschaftscafé
2. November 2017, von Tobias Wegener

Foto: KNU/Wegener
Das KNU veranstaltete am Montag, den 23. Oktober 2017 in Kooperation mit der umdenken. Heinrich-Böll-Stiftung eine weitere Veranstaltung der Reihe „Wissenschaftscafé“ mit dem Titel „Individuelle Freiheit und/ oder gesellschaftliche Verantwortung: Nachhaltigkeit als Probe aufs Exempel“. In der von der Wissenschaftsjournalistin Angela Grosse moderierten Runde diskutierten
- Dr. Willfried Maier (Senator a.D.),
- Prof. Dr. Kai-Uwe Schnapp (Politikwissenschaftler, UHH) und
- Susanne Mira Heinz (Sustainable Innovation, TU Hamburg-Harburg; Design Thinking Coach)
zusammen mit den etwa 50 Teilnehmenden, wie eine nachhaltige Entwicklung realisiert werden könnte, die von demokratischer Entscheidungsfindung und individueller Freiheit getragen wird und nicht auf eine Bevormundung der Bevölkerung hinausläuft.

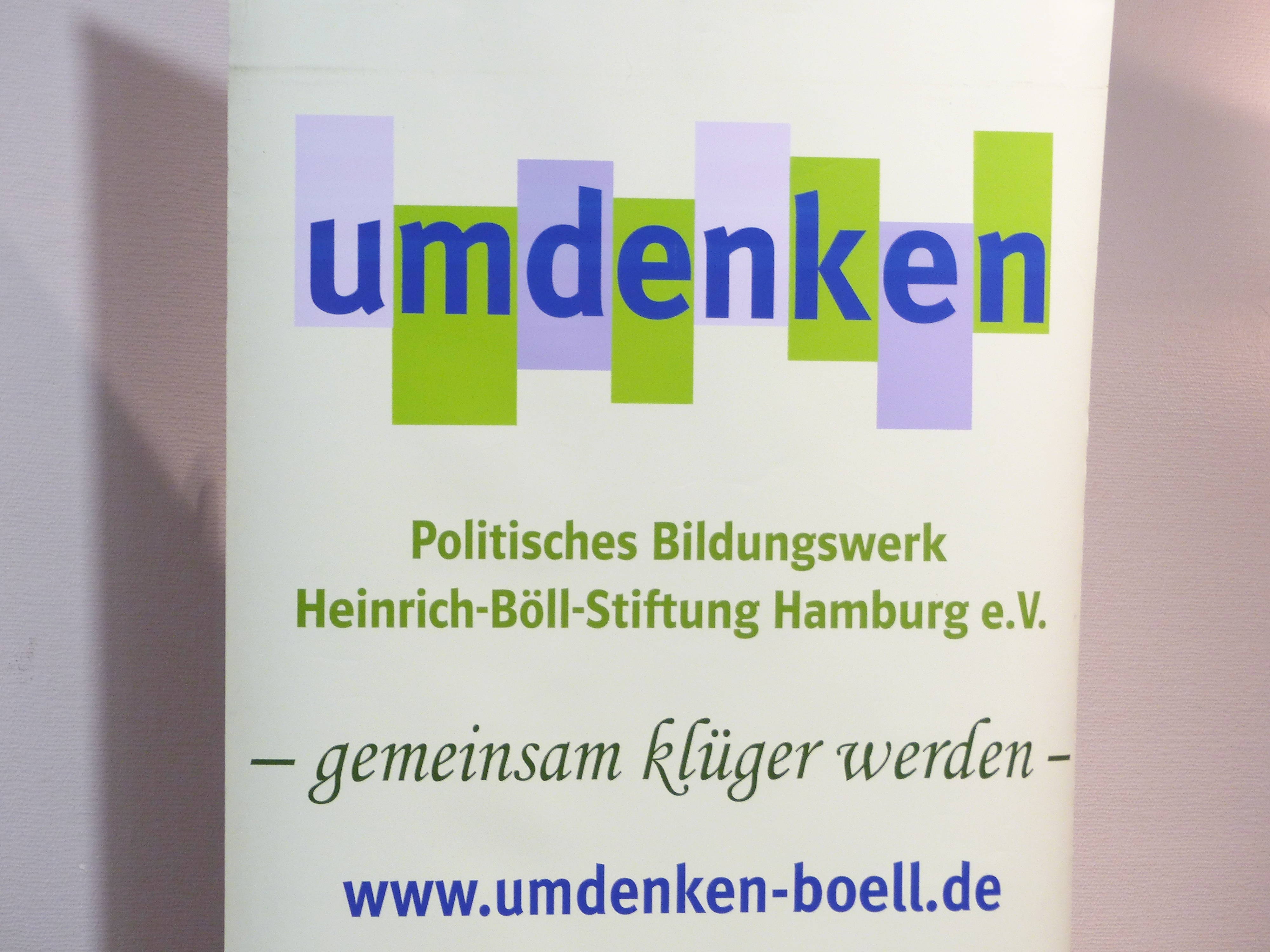

Ein gutes Leben für Alle
Viele unserer täglichen Handlungen haben nicht nur Auswirkungen auf das eigene Leben, sondern betreffen gleichzeitig auch viele andere Menschen. Dies gilt mehr denn je in der globalisierten Welt, wie wir sie heute vorfinden. Häufig gibt es hier ein Ungleichgewicht zwischen dem individuellem Nutzen und den Folgen für die Allgemeinheit, wie z. B. bei der Emission von Treibhausgasen. Wie können etwa knappe Ressourcen und Verschmutzungsrechte gerecht verteilt werden, sodass jeder Mensch die eigenen Bedürfnisse decken und sein Recht auf ein gutes Leben wahrnehmen kann? Liegt die Verantwortung hier bei jedem Individuum oder bedarf es gesellschaftlicher Institutionen für ein funktionierendes Zusammenleben?
Tragik der Allmende: Übernutzung von öffentlichen Gütern

Zur Veranschaulichung dieser Problematik wies Prof. Kai-Uwe Schnapp auf die „Tragik der Allmende“ hin, die auf das 1968 veröffentlichte Essay "The Tragedy of the Commons"[1] vom Ökologen Garrett Hardin zurückgeht: Hardin beschreibt hierin, dass der unbeschränkte Zugang zu knappen Ressourcen unweigerlich zu deren Übernutzung führe. Zwar wisse jeder Einzelne, dass egoistisches Verhalten auf Dauer allen schadet. Trotzdem will keiner der Dumme sein, der selber Maß hält, um dann hilflos mit ansehen zu müssen, wie die anderen profitieren, indem sie die Ressourcen eigennützig weiter ausbeuten. In der Tat wurde diese Tragödie in der Geschichte der Menschheit schon oft erlebt und erlitten: Meere werden überfischt, Wälder abgeholzt, Weideland verödet, Böden verseucht.[2]

Wie kann man diesen Problemen begegnen? Dr. Willfried Maier erklärte, dass häufig zwar ein Problembewusstsein vorhanden sei, dieses aber nicht ausreiche. Stattdessen bedürfe es in diesen Fällen einer regelnden Institution bzw. einer Form von Governance, die ein Monitoring betreibt, Grenzen für die Nutzung von Ressourcen festlegt und Verstöße sanktioniert. Anders sei die Allmende-Problematik nicht einzukriegen.
Ein Beitrag der Wissenschaft: Transdisziplinäre Forschung

Welchen Beitrag kann die Wissenschaft leisten, um eine erfolgreiche lokale Selbstverwaltung öffentlicher Güter zu fördern? Susanne Mira Heinz sieht großes Potential in der sogenannten transdisziplinären Forschung: Hierbei handele es sich um Forschungsprojekte, die ein normatives Ziel verfolgen und darauf ausgerichtet seien, mit Praxispartnern aus dem außeruniversitären Umfeld zusammenzuarbeiten. Ausgehend von einem Nachhaltigkeitsproblem würden möglichst viele Stakeholder zusammengebracht, um die einzelnen Perspektiven und Interessen zusammenzutragen und gemeinsam wünschenswerte Zukunftsszenarien zu erarbeiten. Die Wissenschaft könne hier zu einer erfolgreichen Realisierung beitragen, indem sie Systemwissen, Zielwissen und Transformationswissen generiert und den Praxispartnern zur Verfügung stellt.
Nudging: Kleine Schubser, große WIrkung?
Ein weiteres Thema, das im Wissenschaftscafé im Fokus der Diskussion war, ist das sogenannte Nudging (engl. für Anstupsen). Dabei handelt es sich um ein Konzept, das durch das Buch Nudge. Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness.[3] der Verhaltensökonomen Cass Sanstein und Richard Thaler populär wurde. Spätestens nachdem Thaler für seine Forschungen auf dem Gebiet der Verhaltensökonomik kürzlich mit dem Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften ausgezeichnet wurde, ist dieses Konzept in aller Munde.
Beim Nudging geht es darum, politische Ziele nicht durch Verbote oder Restriktionen zu erreichen, sondern durch sanfte (heimliche) Anstupser in die gewünschte Richtung, ohne dabei die Entscheidungsfreiheit der einzelnen Individuen zu beschränken. Ein Beispiel für Nudging-Strategien ist ein Versuch der kalifornischen Stadt Sacramento: Dort verschickte der lokale Energieerzeuger Informationen an alle Haushalte, wie sich ihr Energieverbrauch im Vergleich zu effizienten Verbrauchern in der Nähe oder zu dem aller Nachbarn darstellt. Schon die einfache Rückmeldung über das eigene Verhalten in Relation zu den Nachbarn motivierte Bürger zum Energiesparen. Die meisten Haushalte verringerten ihren Verbrauch.[2]
Prof. Kai-Uwe Schnapp sieht im Nudging eine wirkungsvolle Methode der Verhaltenssteuerung, die nicht unbedingt die individuelle Freiheit einschränken müsse. Gleichzeitig bestehe aber auch die Gefahr, dass ‒ falsch eingesetzt ‒ der manipulative Charakter dominiert und die Methode nicht länger mit den Grundprinzipien demokratischer Entscheidungsfindung zu vereinbaren sei.
Wie kann es weiter gehen?
Viele Nachhaltigkeitsprobleme sind komplex und schwer überschaubar. Selbst wenn auf individueller Ebene der Wille zu nachhaltigem Handeln gegeben ist, fehlt häufig das Handlungswissen, dies auch umzusetzen. In der Diskussion wurde daher gefordert, mehr Aufwand zu betreiben, den Menschen das nötige Handlungswissen an die Hand zu geben. Mögliche Maßnahmen seien etwa
- eine bessere Wissenschaftskommunikation, die nicht nur wenige Menschen, sondern die breite Masse der Bevölkerung erreicht,
- einen stärkerer Fokus auf Lösungen statt auf Probleme,
- das Erzählen von Geschichten, in denen sich jede*r Einzelne wiederfinden kann sowie
- Initiativgesetzgebungen, die positive Anreize schaffen (wie etwa das EEG Gesetz) und nicht Restriktionen.
Nach dem Ende der Podiumsdiskussion gab es die Möglichkeit, bei Getränken und Snacks miteinander ins Gespräch zu kommen. Es hat sich gezeigt, dass das Thema des Wissenschaftscafés sehr facettenreich ist und ein großes Diskussionspotential liefert – auch und gerade über das Ende der Veranstaltung hinaus.



Fotos und Text: Tobias Wegener
Quellen
[1] Hardin, G. (2009). The Tragedy of the Commons. Journal of Natural Resources Policy Research, 1(3), 243-253.
[2] Kliemt, H. (2009). Die Tragik der Allmende. FAZ. Abgerufen am 30.10.2017.
[3] Leonard, T. C. (2008). Richard H. Thaler, Cass R. Sunstein, Nudge: Improving decisions about health, wealth, and happiness. Constitutional Political Economy, 19(4), 356-360.
